|
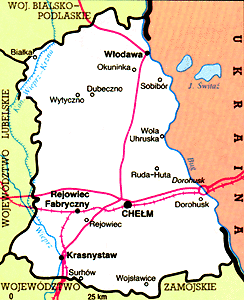
Fortsetzung.
3. Cholm.
Bald hallte die Frontkanonade
und wir warteten auf den Umzug. Die Lastkraftwagen kamen, man stopfte uns
zum Bersten voll in die Wagenkästen hinein, brachte zur Station und
ließ uns in die Güterwagen einsteigen, die nachher geschlossen
wurden. Der Zug setzte sich in Bewegung, von seiner Richtung hatten wir
aber keine Ahnung: das kleine Fenster unter dem Wagendach in der Ecke war
mit den Brettern vernagelt, zwischen denen nur der Himmel zu sehen war. Wir
fuhren einen ganzen Tag lang, auch die Nacht verbrachten wir im Wagen.
Endlich
rollte die Wagentür auf, ein Lastkraftwagen kam an den Wagen heran,
wir wurden in den Wagenkasten hinuntergeworfen und der LKW fuhr ab. Wir
fuhren durch eine Stadt, wahrscheinlich polnische, da die Aufschriften und
Schilder in Polnisch waren, dann kamen wir zum Tor, hinter dem das Lager
war. Lange Reihen der halb in die Erde eingegrabenen Baracken zogen sich
durch das Gelände, jedes davon war mit dem Stacheldraht umgeben. Der
LKW hielt an einem Gebäude, über dessen Eingang eine deutsche
Flagge mit dem Hakenkreuz wehte. Vor dem Gebäude war ein kleiner
Platz, über den deutsche Soldaten sachlich hin und her eilten, etwas
abseits standen einige junge Frauen in der sowjetischen Uniform, sie sangen
im Chor „Erhebe dich, riesiges Land“ und offensichtlich warteten auf etwas.
Die mit den Flinten bewaffneten Wachleute gaben auf ihr Singen keine Acht.
Ich glaube, diese Frauen waren aus dem von den Deutschen eroberten
Feldlazarett. Kurz darauf fuhr der LKW zum Eingang einer der Baracken vor,
wo auf uns schon die Leute warteten, die deutsche Uniform mit
merkwürdigen roten Kragenspiegeln anhatten und russisch sprachen,
wahrscheinlich war es die Lagerpolizeiaufsicht. Einen nach dem anderen
schleppten sie uns in die Baracke hinein.
Der
Gestank in der Baracke haute uns um. Ein halbdunkler Durchgang in der
Mitte, zu dessen beiden Seiten zweistöckige Pritschen standen. Ich
wurde auf einen freien Platz unten gestoßen.
Mein
Nachbar links schlummerte und murmelte etwas dabei, auf meine Fragen
antwortete er nicht. Mein Nachbar rechts informierte mich über alles
gern.
Dieses
Lager galt als ein Lazarett, es wurden hierher die Verwundeten
zusammengebracht. Die Stadt, in der dieses Lager lag, hieß Cholm, die
Polen nannten sie Chelm. Das Füttern war widerlich, die übliche
deutsche Ration: 240-250 Gramm Brot und dünne Suppe einmal am Tage. Am
Ende der Baracke befand sich hinter einer Scheidewand mit der Tür mit
dem Schild „Arzt“ ein Verbandraum. Es mangelte aber am Verbandstoff, man
wurde nur für ein Brotstück verbunden. Darum stank es in der
Baracke so: es eiterten die vernachlässigten Wunden.
Ich
bekam einen Teller Steckrübensuppe, übelriechend, dünn, mit
einer Fleischfaser.
Es
wurde Nacht. Mein Nachbar links hatte offensichtlich Fieber, er
flüsterte etwas, murmelte verschiedene Namen. Gegen den Morgen wurde
er still. Es stellte sich heraus, er war gestorben. Mein Nachbar rechts
sagte: „Sage das vorläufig niemandem. Wenn man das nicht gleich
bemerkt, bekommen wir noch sein Brot und Suppe und teilen das alles.“ So
haben wir gemacht. Erst nach dem „Mittagessen“ berichteten wir das den
Sanitätern und sie brachten ihn weg.
Am
nächsten Tag nahm ich mein Stück Brot und schleppte mich bis zum
Verbandraum. Als ich an die Tür klopfte, ging sie auf und ein junger
Mann in deutscher Uniform mit den roten Kragenspiegeln, auf denen „Arzt“
stand, sah Brot in meinen Händen und ließ mich herein. Er nahm
mir mein Brot als etwas selbstverständliches und begann sich zum
Verband vorzubereiten. Während er in eine Schüssel Revanol
einschenkte und meine Wunden geschickt verband, fragte er mich, wo ich
verwundet worden war, wo ich gedient hatte. Er sagte, ich dürfte erst
nach drei Tagen wieder kommen: es gab keinen Verbandstoff.
Es
zogen sich peinliche Tage, ein jeder konnte der letzte sein. Die Tagen
waren ohne Ende, nur das „Mittagessen“ aus Brot, dem sogenannten Tee und
Suppe half die Zeit bestimmen.
Es gab
kein Waschbecken in der Baracke und auf die Straße konnte ich noch
nicht gehen. Mein längst ungewaschener Körper bedrückte
mich, es juckte mich unerträglich an der Wunde: sie wurde wurmstichig.
MeinNachbar beruhigte mich: es sei gut, mit den Würmern heile die
Wunde schneller.
Von
dem Fenster an der Gegenseite der Baracke aus war ein Stückchen Himmel
und Stacheldraht zu sehen und ein Polizist mit dem Stahlhelm und einer
Flinte hinter sich, der den Stacheldraht entlang hin und her ging.
Jeden
Tag starben die Menschen in der Baracke, die Toten wurden nicht gleich
weggebracht (ihre Nachbarn bekamen für sie noch einige Tage lang Brot
und Suppe).
Manchmal
erschienen in der Baracke „Kaufleute“, die das Essen verkauften oder gegen
ein Kleidungsstück eintauschten. Da ich völlig verhungert war(ich
mußte mich doch auch für das Brot verbinden lassen), fiel ich in
Versuchung und tauschte meine noch anständige Feldbluse gegen ein
Stück abgekochtes Fleisch und ein zerlumptes schmutziges Hemd ein.
Mein Nachbar ließ mir keine Ruhe: „Gib mir doch auch ein
Stückchen!“ Ich konnte ihm nicht absagen und er biß ein
großes Stück ab. Ich glaube, ich kann mich bis jetzt an den
Geschmack von diesem Fleisch erinnern.
Die
Tage vergingen und ich erinnere mich nicht daran, wie lange es dauerte.
Endlich sollten einige und unter ihnen auch ich in ein anderes Lager
übersiedeln. Ich weiß nicht, warum die Lagerleitung diesen Beschluß
faßte. Vielleich sah ich nicht so unterernährt aus. Ich war von
Geburt mager und leidete von Hunger nicht so stark wie die anderen.
4.
Hohenstein.
Diesmal fuhren wir mit einem
Pferdeschlitten, die Pferde wurden von einem jungen polnischen Zivilisten
gelenkt, offensichtlich wurde er für diese Arbeit mobilisiert. In
Begleitung der Fußbegleitsoldaten fuhren wir langsam durch die
Straßen der Stadt vor den Augen der Stadtbewohner, die an den
Straßenrändern standen. Einige von ihnen liefen oft an unseren
Schlitten heran und steckten uns bald ein Stück Brot, bald einen
Apfel, bald Salzkartoffeln. Die Begleitsoldaten schrien sie von Zeit zu
Zeit an, aber nicht böse, nur zum Schein.
Man
brachte uns zur Eisenbahnstation und ließ in die Wagen einsteigen,
deren Boden mit einer dicken Strohschicht bedeckt war. Bald fuhren wir
weiter. Wir fuhren lange, zwei oder drei Tage lang und litten von Durst und
Hunger: nur ein- oder zweimal bekamen wir je ein Zwieback und eine
Schöpfkelle. Endlich hielt der Zug, die Wagentür rollte auf:
gerade davor stand das Stationsgebäude mit dem Schild „Allenstein“.
Es kamen an die Wagen
Pferdefuhrwerke heran und wir fuhren damit zu unserem Wohnort. Es war ein
richtiger Frühlingstag, es gab schon fast keinen Schnee und an den
schneefreien Stellen grünte das Gras. Wir fuhren durch ein
ordentliches deutsches Städtchen mit ein- und zweistöckigen
Gebäuden mit Vorgärten und hohen Ziegeldächern. Von fern sah
das Städtchen wie ein Haufen Zündholzschachteln aus. Das Lager
war schon zu sehen: Stacheldraht, Tor, lange Reihen der umgezäunten
Bauten, die halb als Erdehütten halb als Baracken aussahen. Zuerst
wurden wir zur Badeanstalt gebracht: einem einstöckigen Bau mit einem
hohen rauchenden Schornstein. Wir zogen uns aus, knoteten unsere Kleidung
zusammen, befestigten an dem Knoten ein Schildchen mit der Nummer und gaben
die Sachen den kriegsgefangenen Italienern ab, die hinter einer
Holzschranke darauf warteten. Ein deutscher Gefreiter gab jedem ein
Stück seltsames tonartiges Material, Ersatzseife. Beim Kontakt mit dem
Wasser bedeckte es sich statt des Schaums mit einer Art Schleim, so
daß man mit seiner Hilfe den ganzen Schmutz vom längst
ungewaschenen Körper abwaschen konnte.
Ich
hüpfte auf einem Bein in einen großen Duschraum und duschte mich
dort mit Vergnügen unter einer Duschanlage, aus der heißes
Wasser spritzte, wobei ich mich bemühte den Verband nicht naß zu
machen. Als ich wieder in den Umkleideraum hüpfte, reichte mir einer
der Italiener zwei Bretter mit den Querlatten. So bekam ich die
Krücken.
Nach
dem langen Warten im Umkleideraum bekamen wir unsere Kleidung aus der
Sterilisationskammer. Die Italiener nannten die Nummern fließend russisch und
übergaben uns heiß dampfende Knoten.
Wir
zogen uns an.
Der
deutsche Gefreite (ich hatte schon zahlreiche deutsche unterste
Dienstgradabzeichen gelernt) schrieb auf die Kärtchen unsere Angaben:
Namen, Vornamen, Alter, Dienstgrad, Nationalität, Glaubensbekenntnis
und teilte jedem seine Personalnummer mit, er ließ sie uns deutsch
lernen, denn beim Appel wurden nicht Namen sondern Nummern genannt.
Nach dieser Registration wurden
wir in die Baracken gebracht. Während wir im Umkleideraum warteten,
erfuhr ich, daß das Lager Hohenstein hieß (nun liegt es auf dem
Territorium Polens und heißt Olstinek) und gilt im deutschen
Verzeichnis als Stalag I-A, wo kriegsgefangene Invaliden gehalten werden,
die nicht arbeiten können.
Meine
Baracke stellte eine riesige Art Erdhütte mit vier Reihen Pritschen
dar. Zwei Außenreihen wurden von zwei inneren durch breite
Durchgänge getrennt. Die inneren Pritschenreihen, durch eine niedrige
Scheidewand voneinander getrennt, waren zweistöckig und hatten einige
Querdurchgänge, in denen eiserne Öfen und Tische mit Bänken
standen. An den Stirnseiten waren die Eingänge in die Baracke. Der
Eingang von der breiten Straße, die sich durch das ganze Lager zog
und von den Baracken durch einen Stacheldraht getrennt war, galt als
Haupteingang. Durch diese Straße gingen mit den Flinten bewaffnete
Wachleute. Der andere Eingang war auf die Außenumzäunung
gerichtet, die aus vier Reihen Stacheldraht und dazwischen Bruno-Spiralen
bestand. Zwischen der Außenumzäunung und der Baracke lag die
Sanitätszone, in der sich ein ziemlich sauberer Abort mit Betongrube
und ein Waschbecken – ein Betontrog mit Wasserhähnen – befanden.
Jenseits der Umzäunung standen Wachtürme, 100-150 Meter
voneinander entfernt, wo die Wachposten und Maschinengewehrrohr zu sehen waren.
Hinter der Umzäunung war ein nicht sehr hoher Hügel zu sehen, auf
dem ein merkwürdiger Bau stand: ein quadratischer Ziegelturm mit
Zinnen, nach oben etwas enger. Es stellte sich heraus, daß es das
Denkmal für den Sieg der Deutschen über die russische Armee von
General Samssonow im ersten Weltkrieg ist. Zu beiden Straßenseiten
zogen sich Reihen der gleichen Baracken, voneinander durch einen
Stacheldraht getrennt.
Am
Barackenhaupteingang war durch eine Scheidewand ein kleiner Raum für
den Ältesten und den Dolmetscher abgetrennt. Hier hatte ein für
unsere Baracke verantwortlicher deutscher Gefreiter täglich seinen
Dienst
Der Älteste wies mir meinen
Platz auf der Pritsche an und somit auch meine Brigade. Mein Nachbar war
ein junger netter Tadschike, der sich rührend um seinen älteren
Landsmann kümmerte, der auf der weiteren Pritsche lag. Er litt an
Magengeschwür und war vor Schmerz ganz aufgelöst. Links von mir
war ein Ukrainer, der bei Mariupol gewohnt hatte, ein Mann an die vierzig
Jahre alt. Er amüsierte mich mit seinen Erzählungen über
seine Arbeit und seine Liebesabenteuer mit „einem schönen Weib“, das
sowohl seine sexuellen Bedürfnisse befriedigte, als auch ihn reichlich
nährte.
Die
Brigaden wurden nach folgendem Prinzip gebildet: für eine Gruppe aus
12 Menschen ein Brot, für vier Gruppen ein Topf Suppe oder Tee.
Es
begann meine nächste Lebensetappe in der Kriegsgefangenschaft.
|